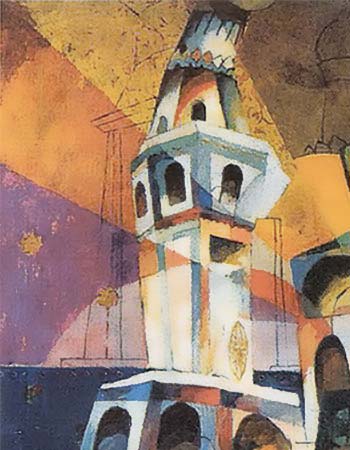Subtotal: $
Checkout
Haben die ersten Christen Jesus verstanden?
von Gerhard Lohfink
Donnerstag, 31. März 2016
Verfügbare Sprachen: English
Es gibt Texte, die so verblüffend sind, dass sie immer wieder zitiert werden. Zu diesen Texten gehört der nun schon über 100 Jahre alte Satz des französischen Bibelwissenschaftlers Alfred Loisy: „Jesus verkündete das Reich Gottes – und was kam, war die Kirche“footnote. Ich gehe jetzt nicht der Frage nach, wie Loisy selbst diesen Satz verstanden hatfootnote. Ich frage vielmehr, wie der Satz von denen verstanden wird, die ihn genüsslich zitieren. Meistens verstehen sie ihn als bittere Ironie.
Da sei auf der einen Seite das Reich Gottes, wie Jesus es verkündet habe: die große, umfassende, unfassliche Verwandlung der Welt unter die Herrschaft Gottes – und dann nach Ostern die Kirche: eine Größe mit all den Grenzen, die zu einem gesellschaftlich verfassten Gebilde gehören. Also: ein Abgrund zwischen der Verkündigung Jesu und der Realität nach Ostern! Einerseits die Herrlichkeit des Reiches Gottes – andererseits die bittere Dürftigkeit der real existierenden Kirche.
Ich sage sofort, was ich von einer solchen Gegenüberstellung Reich Gottes / Kirche halte: Nichts, gar nichts! Denn sie reißt eine Kluft zwischen dem Wollen Jesu und der Wirklichkeit der Kirche auf, die weder Jesus noch der Kirche gerecht wird. Warum?
Zunächst einmal deshalb, weil auch Jesus die kleinen, völlig unscheinbaren Anfänge des Reiches Gottes geschildert hat. Ich erinnere an die Metaphern Senfkorn, Sauerteig, gefährdete Saat und im Stillen wachsende Saatfootnote.
Zweitens, weil das Reich Gottes, das Jesus verkündete, keine Realität jenseits der Gesellschaft ist. Dazu hat man das Reich Gottes zwar immer wieder machen wollen: Man hat es in die ferne Zukunft verlegt oder in die absolute Transzendenz oder in die Tiefe der menschlichen Seele. In Wirklichkeit aber meint das Reich Gottes bei Jesus konkrete gesellschaftliche Realität. Die Basileia Gottes hat ihren Ausgangspunkt in einem realen Volk. Die Weltverwandlung durch die Gottesherrschaft muss in Israel beginnen.
Reich Gottes und Volk Gottes sind zwar nicht dasselbe. Aber sie stehen in einer festen Korrelation. Jesus lässt in der 2. Vaterunserbitte um das Kommen des Reiches beten. Aber unmittelbar davor, in der 1. Bitte, lässt er beten um die Sammlung und Heiligung des Gottesvolkes. Genau das ist nämlich mit der Bitte „geheiligt werde dein Name“ gemeintfootnote. Im Hintergrund steht dabei die Theologie des Ezechiel-Buchesfootnote.
Jesus proklamiert das Reich Gottes, aber er proklamiert es nicht nur, sondern er beginnt mitten in Israel mit der realen Weltveränderung, die mit der Gottesherrschaft gemeint ist. Die Proklamation des Reiches Gottes ist verknüpft mit der Sammlung Israelsfootnote.
Und da die Kirche nichts anderes ist als das auf Jesus hörende, ihm nachfolgende, durch ihn geheiligte Israel, sind Reich Gottes und Kirche aufs Engste miteinander verknüpft. Dass Jesus das Reich verkündete und dann nach Ostern die Kirche kam, war kein tragischer Absturz, war keine bittere Ironie der Geschichte, war keine Perversion des Willens Jesu, sondern hing konsequent mit der gesellschaftlichen Dimension der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu zusammen.
Vor diesem Hintergrund möchte ich im Folgenden der Frage nachgehen, ob die Frühe Kirche das, was Jesus wollte, begriffen und gelebt hat. Allerdings: Ein so weit gespanntes Thema erforderte eigentlich bedeutend mehr Zeit. Ich versuche deshalb das, was anhand vieler Phänomene zu untersuchen wäre, mithilfe von drei Stichproben zu erkunden: 1. Gewaltverzicht, 2. Nächstenliebe und 3. Naherwartung. Weshalb ich gerade diese drei Stichproben gewählt habe, werde ich jeweils begründen.
Die Naherwartung bei Jesus und in der Frühen Kirche
Ich habe diese Stichprobe bewusst gewählt, weil fast niemand mehr mit Naherwartung etwas anfangen kann – Bischöfe und Pfarrer nicht ausgenommen. Das Thema „Naherwartung“ ist tot. Dabei wäre es so notwendig, von ihm zu sprechen.
Jesus hat das Reich Gottes, er hat die Gottesherrschaft verkündet. Doch das wäre an sich nichts Neues gewesen. An die Herrschaft Gottes glaubten viele in Israel. Auch, dass diese Herrschaft sich bald offenbaren, dass sie sich schon in naher Zukunft zeigen und durchsetzen werde, erhofften jüdische Gruppen zur Zeit Jesu, zum Beispiel die Zeloten und die Gemeinschaft, deren Schriften in Qumran gefunden wurden.
Das Besondere bei Jesus ist, dass er verkündet: Das Reich Gottes kommt nicht nur in naher Zukunft, nein, es kommt jetzt. In den Machttaten, sagt Jesus, die ich in der Kraft Gottes wirke, ist es schon dafootnote, und es verwandelt nun Zug um Zug und unaufhaltsam das Gottesvolk und über das Gottesvolk die Welt.
Man könnte dialektisch von einer verborgen-offenbaren Gegenwart des Reiches sprechen, die sich in immer größere Zusammenhänge hinein realisiert. Nur insofern kann das Reich noch „kommen“ und es muss um sein „Kommen“ gebetet werden. In seiner Fülle und Vollendung ist es noch nicht da. Aber es ist nahe. Es ist so nahe, dass die Hörer Jesu jetzt umkehren müssen. Es bleibt keine Zwischenzeit mehr, in der man die Umkehr noch aufschieben könnte. Jetzt, heute müssen die Hörer und Hörerinnen Jesu sich entscheiden, das Reich glaubend annehmen und in seiner Kraft tätig werden. Und sie müssen sich nicht nur Gottes wegen entscheiden, sondern auch wegen der Not Israels und wegen des unermesslichen Leids der Welt.
Ich frage mich, ob Jesus innerhalb des eschatologischen Denkens seiner Umwelt, in dem er selbst tief verwurzelt war, dieses drängende „Jetzt“ der Entscheidung überhaupt anders hätte sprachlich erfassen und ausdrücken können als durch die Vorstellung zeitlicher Naherwartung. Sind denn wir selbst mit unserem Vorstellungshorizont von der endlos weiterlaufenden Zeit, in der es keinen wirklichen kairos mehr gibt, sondern nur noch events – sind denn wir der Wahrheit unserer Existenz und der Wahrheit menschlicher Geschichte wirklich näher als Jesus mit seiner eschatologischen Zuspitzung? Ich bezweifle es auf das Heftigste.
Selbstverständlich müssen wir die eschatologische Sprache Jesu übersetzen. Wenn das geschieht, zeigt sich: Nicht Jesus hat sich getäuscht, sondern wir selbst täuschen uns unablässig. Nicht nur über die Brüchigkeit und Ausgesetztheit unseres Lebens, sondern auch über die Nähe Gottes.
Und nun wieder die Frage: Ist die Frühe Kirche auch in dieser Sache Jesus nachgefolgt? Ist sie ihm auch hier treu geblieben? Diese Frage darf nicht in einer vordergründigen Weise gestellt werden. Das heißt: Wir dürfen nicht fragen: Hat die Urkirche und hat die Frühe Kirche das Schema der zeitlichen Naherwartung übernommen und beibehalten?
Wir müssen vielmehr fragen: Hat die Frühe Kirche das, was mit dem Schema zeitlicher Naherwartung im Kern gemeint war, verstanden, übernommen und gelebt? Hat sie die Gegenwart des Reiches begriffen? Hat sie begriffen: Das Entscheidende geschieht schon, die Befreiung und die Rettung sind schon da? Und hat sie die herandrängende Nähe des Reiches begriffen, die keine Zeit mehr lässt, die Umkehr noch vor sich her zu schieben?
Die Antwort kann nur lauten: Ja, sie hat die Gegenwart und die Nähe des Reiches Gottes begriffen. Sie hat sogar das Schema der zeitlichen Naherwartung noch einige Jahrzehnte lang benutzt. Paulus kann noch formulieren:
Die Stunde ist gekommen, dass wir aufstehen vom Schlaf. Denn jetzt ist uns das Heil näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. (Röm 13,11-12)
Die Kirche bleibt also noch eine Zeit lang im Schema zeitlicher Naherwartung. Doch noch während sie dieses Vorstellungsschema verwendet, baut sie es schon um. Sie redet immer weniger vom Reich Gottes bzw. von der Gottesherrschaft, und sie redet immer seltener von zeitlicher Naherwartung. Etwas anderes tritt an die Stelle dieser Begriffe und greift dabei exakt das auf, was mit diesen Begriffen innerhalb des jüdischen Vorstellungshorizonts gemeint war.
Es ist die Geist-Theologie der Frühen Kirche, es ist die Aussage von der Gegenwart des Geistes. Der Heilige Geist ist die Eröffnung der Endzeitfootnote. Der Heilige Geist ist das Angeld der Vollendung. Im Heiligen Geist wird die Welt neu geschaffen auf ihre Vollendung hinfootnote. Im Heiligen Geist ist der Auferstandene bleibende Gegenwart und erfüllt die Kirche mit der Kraft seiner Auferstehungfootnote. Die Geist-Theologie der Frühen Kirche ist also das Äquivalent und die genaue Fortführung der Reich-Gottes-Proklamation Jesu. Wenn wir beten: „Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen werden und du wirst das Angesicht der Erde erneuern“ treten wir ein in die Reich-Gottes-Verkündigung Jesu.
Es muss aber noch etwas hinzukommen. So wie die Reich-Gottes-Proklamation Jesu von Zeichenhandlungen begleitet war – seine Machttaten waren ja Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft –, so setzt sich auch der Geistempfang der Kirche fort in handgreiflichen Zeichen: Ich meine natürlich die Sakramente. Die Sakramente sind eschatologische Zeichenhandlungen.
Beim Herrenmahl ist das evident. Es war gekennzeichnet von dem urkirchlichen Ruf „Komm, Herr Jesus“footnote – der sich heute fortsetzt in dem Ruf der Gemeinde: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit“.
Ähnliches gilt von der Taufe. Sie ist eschatologisches Zeichen, sie versiegelt auf das Ende hin – und doch verpflichtet gerade dieses Sakrament zu einem neuen Leben in der Welt. Wer in der Taufe mit Christus gestorben ist, wird hineingeboren in die neue Gesellschaft der Kirche.
Auch das Sakrament der Versöhnung ist ein eschatologisches Sakrament. Derjenige, der vor der Kirche seine Schuld bekennt, tritt damit hin vor das Endgericht Gottes. Durch den Spruch der Kirche wird der endzeitliche Richterspruch vorweggenommen – als Wort der Vergebung und der Versöhnung.
Die Sakramente enthalten eschatologischen Sprengstoff – und sie sind der Ort, an dem die Kirche die Gegenwarts-Eschatologie Jesu realisiert hat und bis heute realisiert. Oder leider sehr oft nicht realisiert, weil vielen Christen der innere Zusammenhang zwischen den Sakramenten und dem Kommen des Reiches Gottes gar nicht bekannt ist.
Soll ich jetzt eine Serie von Texten zur frühchristlichen Geist-Erfahrung und zur Sakramententheologie der ersten drei Jahrhunderte anfügen? Dann würden diese Ausführungen jedes Maß sprengen. Ich schließe deshalb mit einem einzigen Text. Er stammt von dem großen Theologen und Bischof Cyprian, und zwar aus seiner Schrift „Ad Donatum“. Diese Schrift steht noch ganz unter dem Eindruck der Taufe, die Cyprian kurz zuvor (wahrscheinlich im Jahre 245) empfangen hatte. Sie hat ihn verwandelt.
In einem Selbstbekenntnis, das die Confessiones des Augustinus vorwegnimmt, deutet Cyprian die Unsicherheiten seines früheren Lebens an – die Dunkelheiten, die Abwege, die sittlichen Verirrungen, die Verhärtungen, die fest eingewurzelten Sünden, die Verzweiflungen. Cyprian sagt, er habe das Ablegen des alten Menschen für unmöglich gehalten.
Nachdem aber mithilfe des lebenspendenden Wassers [der Taufe] der Schmutz der früheren Jahre abgewaschen war und sich in die nun entsühnte und reine Brust von oben her das Licht ergossen hatte, nachdem ich den himmlischen Geist eingesogen hatte und durch die zweite Geburt in einen neuen Menschen umgewandelt war, da wurde mir plötzlich auf wunderbare Weise das Zweifelhafte zur Gewissheit, das Verschlossene öffnete sich, die Finsternis hellte sich auf, ausführbar wurde, was vorher schwierig geschienen, und erfüllbar, was für unmöglich gegolten hatte. So konnte man erkennen, dass irdisch gewesen, was vorher im Fleische geboren war und im Dienste der Sünde stand, und dass Gottes Eigentum geworden war, was nunmehr der Heilige Geist belebtefootnote.
Cyprian beschreibt seine Taufe durchaus mit Worten der Schrift. Aber die alles umstürzende eigene Erfahrung trägt und durchdringt den Text. Ähnlich muss es zahllosen Christen ergangen sein. Anders wäre der Mut der Vielen, die Verfolgung und Martyrium durch die kaiserlichen Behörden auf sich nahmen, nicht zu erklären. Auch Cyprian starb als Märtyrer. In der Valerianischen Verfolgung wurde er am 14. September 258 nahe bei Karthago enthauptet.
Im Geistempfang der Taufe erfuhren die Christen der Frühen Kirche die Kraft der Gottesherrschaft. Sie wussten, dass mit der Taufe für sie ein neues Leben begonnen hatte. Sie lebten fortan im „Heute“ des Reiches Gottes.
Gerhard Lohfink, Haben die ersten Christen Jesus verstanden?, in: Gerhard Lohfink, Im Ringen um die Vernunft. Reden über Israel, die Kirche und die Europäische Aufklärung, Freiburg im Breisgau (Verlag Herder) 2016, 165-186.
© Herder Verlag
Fußnoten
- A. Loisy, L’Évangile et l’Église, Bellevue 1903, 155.
- Vgl. dazu ausführlich: G. Heinz, Das Problem der Kirchenentstehung in der deutschen protestantischen Theologie des 20. Jahrhunderts (tts 4), Mainz (Grünewald) 1974, 122-139.
- Senfkorn: Mk 4,30-32; Sauerteig: Mt 13,33; gefährdete Saat: Mk 4,1-9; im Stillen wachsende Saat: Mk 4,26-29.
- Vgl. G. Lohfink, Das Vaterunser neu ausgelegt, Stuttgart (Verlag Katholisches Bibelwerk) 22013, 51-59.
- Vgl. vor allem Ez 20,22.41.44; 36,22-28.
- Zu der jesuanischen Korrelation Reichgottesverkündigung / Sammlung des Gottesvolkes vgl. ausführlich G. Lohfink, Jesus von Nazaret. Was er wollte, wer er war, Freiburg i. Br. (Herder) 42014, 66-91.
- Eine knappe und äußerst präzise Skizze der ganzen Frage bei Ch. W. Troll, Koran, Gewalt, Theologie: Christ in der Gegenwart 2014, Nr. 43, 485-486.
- Ausführlicher: G. Lohfink / L. Weimer, Maria – nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis, Freiburg i. Br. (Herder) 22012, 223-229.
- Dazu im Einzelnen: G. Lohfink, Wem gilt die Bergpredigt? Beiträge zu einer christlichen Ethik, Freiburg i. Br. (Herder) 1988, 42-45.
- Vgl. ausführlicher zu diesem 3. Punkt W. Wink, Verwandlung der Mächte. Eine Theologie der Gewaltfreiheit. Hrsg. von Thomas Nauerth und Georg Steins, Regensburg (Pustet) 2014.
- Vgl. zu diesem Thema jetzt die grundlegende Monographie von M. P. Maier, Völkerwallfahrt im Jesaja-Buch (BZAW 474) , Berlin (Walter de Gruyter) 2015.
- Zum Folgenden ausführlicher: G. Lohfink, Wem gilt die Bergpredigt (s. o. Anm. 49) 161-192.
- Vgl. dazu mit vielen Quellenbelegen: G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Kirche im Kontrast (aktualisierte Neuausgabe), Stuttgart (Verlag Katholisches Bibelwerk) 2015, Teil IV.
- So zum Beispiel Tacitus, Annalen XV 44,2-5.
- Athenagoras, Presbeia 11; Übersetzung: A. Eberhard.
- Ein Auswahl wichtiger Literatur zu diesem Thema: A. v. Harnack, Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten, Darmstadt 1963 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft). Nachdruck der Ausgabe Tübingen (Mohr) 1905; H. v. Campenhausen, Der Kriegsdienst der Christen in der Kirche des Altertums: Universitas 12 (1957) 1147-1156; H. Karpp, Die Stellung der Alten Kirche zu Kriegsdienst und Krieg: Evangelische Theologie 17 (1957) 496-515. Vor allem aber: H. Ch. Brennecke, ,An fidelis ad militiam converti possit?‘ [Tertullian, de idolatria 19,1] Frühchristliches Bekenntnis und Militärdienst im Widerspruch?, in: D. Wyrwa (Hrsg.), Die Weltlichkeit des Glaubens in der Alten Kirche (FS Ulrich Wickert) (BZNW 85), Berlin / New York (De Gruyter) 1997, 45-100.
- Vgl. nur Tertullian, De corona 1 (solus fortis inter tot fratres commilitones); 42-43; Apologeticum 5,6; 37,4; 42,3; Eusebius, Kirchengeschichte VI 41, 22-23; VII 11,20; VII 15-16; VIII 1,7.
- H. v. Campenhausen, Kriegsdienst (s. o. Anm. 14) 1148: „Kein einziger Kirchenvater hat daran gezweifelt, dass in der Welt, so wie sie ist, Kriege geführt werden müssen, und sie finden demgemäß auch keine Veranlassung, den Soldatenstand besonders zu verurteilen.“
- Wichtig ist neben Origenes vor allem Tertullian, De corona und De idololatria 19; vgl. auch Laktanz, Institutiones divinae VI 20,15-17. Die Diskussion, ob man als Christ Soldat sein darf, beginnt also erst im 3. Jahrhundert.
- Vgl.Origenes, Contra Celsum VIII 68.73.75.
- Hingegen übergehen die Canones von Elvira die Frage des Militärdienstes von Christen völlig, obwohl sie sich ausführlich mit Fragen des christlichen Lebens inmitten der heidnischen Gesellschaft befassen. Siehe H. Ch. Brennecke, Frühchristliches Bekenntnis (s. o. Anm. 55) 93.
- Traditio Apostolica des Hippolyt, Kanon 16. Für den lateinischen Originaltext siehe B. Botte, La Tradition Apostolique de Saint Hippolyte. Essai de Reconstitution (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 39), Münster (Aschendorff) 31966, 36.
- Im Imperium Romanum waren Zivilgewalt und Militärgewalt nicht getrennt. Militia kann beides bedeuten. Miles meint normalerweise den Soldaten, kann aber auch einen kaiserlichen Beamten bezeichnen, der Waffen trägt.
- Im antiken Judentum gibt es keine Texte, die wie Jesus Gottes- und Nächstenliebe nebeneinandergestellt, miteinander verbunden und zur Mitte der Tora gemacht hätten. Am nächsten kommen dem noch Texte aus den „Testamenten der zwölf Patriarchen“, wobei allerdings nach wie vor umstritten ist, ob es sich hier nicht um eine judenchristliche Schrift oder um eine jüdische Grundschrift mit christlichen Interpolationen handelt. – Vgl. zu dem Nebeneinander von Gottes- und Nächstenliebe im antiken Judentum die breit angelegte Untersuchung von A. Nissen, Gott und der Nächste im antiken Judentum. Untersuchungen zum Doppelgebot der Liebe (WUNT 15), Tübingen (Mohr) 1974, bes. 230-244. Nissen betont: „Eine Verknüpfung von Dt 6,5 und Lev 19,18 ist übrigens in der gesamten antik-jüdischen Literatur zumindest bis ins Mittelalter nirgendwo belegt!“ (241 Anm. 642)
- Vgl. 1 Thess 5,15; Gal 6,9-10; ferner 1 Petr 2,17.
- Justin, 1. Apologie 67; Übersetzung: G. Rauschen.
- Eusebius, Kirchengeschichte IV 23,10; Übersetzung: Ph. Haeuser / H. A. Gärtner.
- Es handelt sich um Christen, die zur Schwerstarbeit in die Bergwerke, zum Beispiel in die Eisenbergwerke Sardiniens, deportiert worden waren. Sieh dazu A. Hamman, Die ersten Christen, Stuttgart (Reclam) 1985, 155-156.
- Eusebius, Kirchengeschichte VII 22, 7-10; Übersetzung: P. Haeuser / H. A. Gärtner.
- Julian, Epistola Nr. 39 Weis; Nr. 49 Hertlein; Nr. 22 Wright; Nr. 84 a Bidez-Cumont. Für den, der die Briefe des Kaisers Julian lesen will, empfiehlt sich die schöne Ausgabe von B. K. Weis, Julian. Briefe. Griechisch und Deutsch, München (Heimeran) 1973.
- Julian, ep. 48, 305 C; Übersetzung: B. K. Weis.
- Vgl. vor allem Lk 11,20; 17,21.
- Vgl. Apg 2,14-21.
- Vgl. Mt 12,28; Röm 8,18-30; 2 Kor 1,22; 5,5; Hebr 6,4-5.
- Vgl. Röm 8,9-11.
- Vgl. 1 Kor 16,22; Offb 22,20: Didache 10,6.
- Ad Donatum 4; Übersetzung: J. Baer.

Der Gewaltverzicht bei Jesus und in der Frühen Kirche
Weshalb gerade das Beispiel „Gewaltverzicht“? Der Grund liegt auf der Hand. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Islam überall in der Welt nicht nur stärker ausgebreitet. Er tritt auch mit einem neuen Selbstbewusstsein auf. Dagegen wäre nichts zu sagen. Doch leider entstehen innerhalb des weiten Geländes des Islam in zunehmender Wucht terroristisch-islamistische Bewegungen, die nicht nur „heilige Kriege“ führen, sondern die Gewalt ausdrücklich im Programm haben und sich dafür auf den Koran berufenfootnote. Mord wird von diesen Bewegungen als Gottesdienst ausgegeben.
Solche menschenverachtende Gewalt lässt bei vielen aufgeklärten Frauen und Männern den Widerwillen gegen Religion, den sie sowieso schon in sich tragen, noch wachsen. Das Christentum (und Israel) werden in diesen Widerwillen miteinbezogen. Man hört heute sogar immer häufiger die Behauptung, alle monotheistischen Religionen hätten von Natur aus einen tief eingefleischten Drang zur Gewalt. Und dann werden wiederum Israel, die Kirche und der Islam in einem Atemzug genannt.
Demgegenüber kann nicht oft genug und nicht deutlich genug gesagt werden: Schon das alttestamentliche Israel hat in seinen Spitzentexten auf jede Gewalt verzichtet. Die radikale Gewaltlosigkeit Jesu hat ihre Wurzeln im Alten Testament – und zwar vor allem in der Theologie vom Gottesknecht. Die entsprechenden Texte stehen in den Kapiteln 40-55 des Jesaja-Buches. Mit dem Gottesknecht ist das nach Babylon deportierte Israel gemeint. Der Gottesknecht Israel schreit nicht und lärmt nicht (Jes 42,2). Er erwartet seine Rechtfertigung angesichts des Unrechts, das ihn trifft, allein von Gott (Jes 49,4). Er hält seinen Rücken denen hin, die ihn schlagen (Jes 50,6). Und er tut seinen Mund nicht auf gleich einem Lamm, das man zum Schlachten führt (Jes 53,7).
Die sogenannten Gottesknechtslieder im Jesaja-Buch reden von dem geschlagenen, verschleppten, geknechteten Israel, das allein auf Gott setzt und gerade durch seinen absoluten Gewaltverzicht zum Heil für die Völker wirdfootnote.
Nun ist es aber so: Ausgerechnet das Jesaja-Buch hat in Israel die bis dahin geltende Alleinverehrung JHWHs, die durchaus noch mit der Existenz anderer Götter rechnete, abgelöst und reinen Monotheismus dagegen gesetzt. Das bedeutet: Genau zu der Zeit und genau an der Stelle, wo sich in Israel der Monotheismus durchsetzt, entstehen im Gottesvolk die eindeutigsten Texte für radikale Gewaltlosigkeit. Folgerung: Wer Gewalt an den Monotheismus koppeln möchte, mag sich im Koran umsehen. Vom Monotheismus der Bibel aber sollte er die Finger lassen, sonst zeigt er seine krasse Ignoranz.
Andererseits muss man natürlich zugeben: Im vergewaltigenden und mordenden Islamismus zeigt sich Religion in einer so widerwärtigen Gestalt, dass man den Zorn vieler Menschen gegen die Religion verstehen kann. Umso notwendiger ist es in diesen Jahren, das Ethos Jesu wahrzunehmen: Jesu absolute Gewaltlosigkeit, seine Aufforderung, sich lieber unter Verlust seiner Ehre ins Gesicht schlagen zu lassen, als zurückzuschlagen (Mt 5,38-42). Jesus war überzeugt, dass letztlich nur so die Gewalt-Eruptionen der Gesellschaft eingedämmt werden können.
Ich denke, dass ich darauf verzichten darf, nun die Aufforderungen Jesu zum Gewaltverzicht innerhalb der Bergpredigt im Einzelnen vorzuführenfootnote. Ich möchte nur auf drei Dinge hinweisen:
1. Die Bergpredigt richtet sich an die Jünger Jesu und über seine Jünger an das ganze Gottesvolk Israel. Die Aufforderungen Jesu zum Gewaltverzicht sind kein Programm für den Staat. Der Staat darf nicht jedem geben, der ihn bittet; der Staat darf nicht auch noch die andere Backe hinhalten, und dem Staat kann nicht der Satz gelten: „Leistet dem Bösen keinen Widerstand“ (Mt 5,39). Die Bergpredigt ist gedacht für ein Gottesvolk, das als Volk inmitten der Völker die Reich-Gottes-Praxis Jesu lebt und so zum Zeichen des Friedens für die Völker wird.
2. Bei seinen Aufforderungen zum Gewaltverzicht redet Jesus genau wie an vielen anderen Stellen in prophetisch-zugespitzter Sprache. Das ändert aber nichts daran, dass er auf reale Verhaltensweisen abzielt, die als solche einzulösen sind und die modellartig analoge Fälle beleuchten. Jesus untersagt seinen Jüngern tatsächlich das Anwenden von Gewalt, und er ist überzeugt, dass jeder, der sein Wort annimmt, ohne Gegengewalt und Wiedervergeltung leben kann.
3. Der Gewaltverzicht, den Jesus verlangt, ist kein rein passives, ohnmächtiges, sich der Gewalt des Gegners hinduckendes Hinnehmen. Die konkreten Beispiele, die in der Bergpredigt angeführt werden, haben durchaus etwas Provokatives, das den, der Gewalt zufügt, verändern möchte, indem es ihn betroffen und nachdenklich macht. Auch noch die andere Wange hinhalten (Mt 5,39), will den Gewalttäter geradezu erschrecken. Und wenn einer dem, der ihm vor Gericht das Untergewand abverlangt, auch noch das Obergewand hinwirft (Mt 5,40), entsteht eine beschämende Situation: dann steht der Arme und Rechtlose nackt da. Es ist kein unterwürfiges, hündisches Hinnehmen, es ist eher gewaltloser Widerstand, der da geleistet wirdfootnote.
4. Die Aufforderungen Jesu zum Gewaltverzicht finden sich nicht nur in der Bergpredigt. Sie bilden auch den Hintergrund der großen Aussendungsrede in Mk 6, Mt 10 und Lk 9 und 10. Jesus verbietet seinen Jüngern, wenn sie durch Israel ziehen, um überall die Gottesherrschaft auszurufen, unterwegs Sandalen zu tragen (Lk 10,4), einen Stock mitzuführen (Lk 9,3) und Geld in der Tasche zu haben (Lk 10,4). Nicht einmal Brot dürfen sie mitnehmen (Mk 6,8).
Damit sollte keineswegs jene Art von Bedürfnislosigkeit imitiert werden, wie sie damals kynische Wanderphilosophen demonstrierten. Die fehlende Ausrüstung der Jünger soll vielmehr als ein „Zeichen“ wahrgenommen werden, das sie von der Kampfbereitschaft der antirömischen Widerstandskämpfer unterscheidet. Wer keinen Stock bei sich hat, kann sich nicht verteidigen; wer kein Schuhwerk an den Füßen hat, kann auf dem steinigen Boden Palästinas nicht einmal die Flucht ergreifen. Wer kein Geld mit sich führt, ist mittellos, hilflos und völlig angewiesen auf Sympathisanten innerhalb der Jesusbewegung. Für Jesus war diese sofort erkennbare Unterscheidung von den „Gotteskriegern“ seiner Zeit von fundamentaler Notwendigkeit. Die Jesusbewegung durfte nicht mit den Strategien der Zeloten verwechselt werden.
Hat nun die junge Kirche diesen radikalen Gewaltverzicht, der für Jesus ein Signal der ankommenden Gottesherrschaft war, begriffen und gelebt? Das ist die erste Frage, um die es hier geht.
Allerdings: Die Beantwortung dieser Frage wirft zwei Probleme auf. Zunächst: Es wäre schön, wenn wir über das reale Leben der Christen in den drei ersten Jahrhunderten noch viel mehr wüssten. Doch die Quellen sprudeln nicht gerade stark. Wir sind gezwungen, Rückschlüsse zu ziehen aus Predigten der Kirchenväter oder aus den Schriften der sogenannten Apologeten, die den christlichen Glauben gegen die Vorwürfe der Heiden verteidigt haben.
Außerdem stellt sich natürlich die Frage: Darf eine Glaubensgemeinschaft nur nach dem beurteilt werden, was sie de facto lebt? Juden wie Christen wussten stets, dass sie weit hinter dem zurückblieben, was sie tun sollten. Sie wussten, dass es auch in ihrer Mitte immer wieder schwere Schuld gab: Mord, Streit, Ehebruch, Rivalitäten, Religionskämpfe, Verbrechen jeder Art. Juden wie Christen wussten, dass sie Gott immer von neuem entgegenarbeiteten, angesichts seiner Verheißungen murrten und ständig umkehren mussten.
Ich will also im Folgenden keineswegs ein romantisch verklärtes Bild einer makellosen und heroischen kirchlichen Frühzeit anpreisen. Es gab auch damals in der Kirche schreckliches Elend, jämmerliche Feigheit und tiefe Schuld. Weil aber heute viele fast nur noch die Kriminalgeschichte des Christentums interessiert, müssen wir umso dringender auch über die andere Seite reden: über die Treue der Frühen Kirche zum Evangelium. Außerdem dürfen wir nicht nur auf das schauen, was die Christen waren, sondern genauso auf das, was sie sein wollten.
Das wird sofort deutlich, wenn wir einen ersten Text in den Blick nehmen: 1 Kor 6,1-8. Dieser Text zeigt: Mitglieder der Christengemeinde von Korinth hatten untereinander Rechtsstreitigkeiten und gingen damit vor heidnische Richter. Paulus ist darüber empört. Er hält das für eine Perversion des Evangeliums. Die Gemeindemitglieder sollen ihre Streitigkeiten untereinander regeln. Das legt Paulus in einer ersten Reihe von Argumenten dar. Doch dann bohrt er tiefer und greift dabei auf die Bergpredigt Jesu zurück: Er schreibt der Gemeinde von Korinth: Warum wehrt ihr euch überhaupt? Warum leidet ihr nicht lieber Unrecht? Warum lasst ihr euch nicht lieber ausrauben? (1 Kor 6,7)
1 Kor 6 macht deutlich: Die heidnische Lebensweise sitzt der Gemeinde von Korinth noch tief im Fleisch: Streit, Rivalitäten, Rechtshändel! Paulus erklärt ihnen deshalb: So darf es nicht sein. Solche Lebensweise hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun (6,10). Ihr seid doch durch Christus Geheiligte (6,11).
Es kommt also bei den Fragen, um die es jetzt geht, nicht nur auf die gelungene Realisierung an, sondern auch auf das Bewusstsein, das die Realität formen möchte. War sich die junge Kirche der Bergpredigt bewusst? War das Wissen lebendig, dass Jesus Gewaltlosigkeit gefordert hatte?
Fragt man auf dieser Ebene, so stoßen wir auf ein geradezu spannendes Phänomen. Das Jesaja-Buch hatte in seinem 2. Kapitel geschildert, wie einst die heidnischen Völker zum Zionsberg kommen würdenfootnote. Sie würden kommen aus ihrer Ausweglosigkeit und Existenznot heraus und dem Schrecken ihrer ständigen Kriege. Sie würden kommen, um von Israel zu lernen. Vor allem, um zu lernen, wie man die alles verwüstenden Kriege beenden kann. Denn vom Zion aus ergeht dann das klärende und alles erhellende Wort Gottes. In genau diesem Zusammenhang fällt das berühmte Wort:
Dann schmieden sie [die Völker] Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. (Jes 2,4)
Die Theologen der jungen Kirche haben dieses Prophetenwort auf die Heidenkirche bezogenfootnote. Sie haben gesagt: Der Zionsberg ist die Kirche. Dort ergeht das Wort Jesu. Wir, die Heidenchristen, haben uns zum wahren Gott auf den Weg gemacht. Wir haben, als wir getauft wurden, gelernt, unsere Waffen abzulegen. Wir haben unsere Schwerter und Lanzen umgeschmiedet zu Werkzeugen des Friedens. Wir üben nicht mehr für den Krieg. Jesaja 2 hat sich bereits erfüllt. Die Prophetie des Jesaja ist Realität geworden. Wir gebrauchen keine Gewalt mehr.
Sie finden diese Auslegung von Jesaja 2 bei allen großen Theologen der jungen Kirche: bei Justin, bei Irenäus, bei Tertullian, bei Origenes, bei Athanasius. Aber entsprachen ihre Auslegungen wirklich der Realität? Oder war es „nur“ Theologie? Auch das wäre schon sehr viel.
Dennoch wäre es schön, wenn die Theologen das alles nicht nur gesagt, sondern wenn die christlichen Gemeinden es auch gelebt hätten. Und hier, an dieser Stelle, kommen nun die sogenannten Apologeten ins Spielfootnote.
Die Apologeten, nicht selten ehemals heidnische Philosophen, die Christen geworden waren, verteidigen das Leben der Christen. Weil die Christen bei vielen heidnischen Gebräuchen und Praktiken einfach nicht mitmachten und sich schlicht verweigerten, warf man ihnen „Hass gegen das Menschengeschlecht“ vorfootnote und unterstellte ihnen alle möglichen Gräueltaten. Die Apologeten hielten dagegen, indem sie das wahre Leben der Christen schilderten. Die Schriften aller Apologeten durchzieht ein großes und unerschütterliches Vertrauen, dass die christliche Praxis von selbst überzeugen werde. Sie sagen ihren heidnischen Lesern immer wieder: Wir haben nicht nur die wahre Philosophie, sondern auch die richtige Praxis, und beides steht in einem tiefen Zusammenhang. So schreibt zum Beispiel Athenagoras von Athen um das Jahr 177 in seiner „Presbeia“:
Bei uns könnt ihr ungebildete Leute, Handwerker und alte Mütterchen finden, die, wenn sie auch nicht imstande sind, mit Worten die Nützlichkeit ihrer Lehre darzutun, so doch durch Werke die Nützlichkeit ihrer Grundsätze aufzeigen. Denn nicht auswendig gelernte Worte sagen sie her, sondern gute Taten zeigen sie auf: geschlagen nicht wieder zu schlagen, ausgeraubt nicht zu prozessieren, den Bittenden zu geben, die Nächsten wie sich selbst zu lieben.footnote
Hier wird also unmittelbar die Bergpredigt zitiert. Ähnlich ist es in vielen anderen frühchristlichen Verteidigungen des Christentums. Ich muss mir weitere Texte ersparen. Eines scheint mir sicher: Eine Verteidigungsschrift des christlichen Glaubens musste sich auf reale Lebensformen der Christen berufen können. Sonst wäre sie Schall und Rauch gewesen.
Allerdings bleibt in diesem Zusammenhang eine wichtige Frage: Wie war die Stellung der Frühen Kirche zum Krieg? Haben die Bischöfe ihren Gläubigen verboten, im römischen Heer Kriegsdienst zu leisten? Das wäre ein Test, der vieles klären könnte. Die Forschungslage ist aber schwierigfootnote. Es gab viele Getaufte, die Soldaten wurden, und viele Soldaten, die sich taufen ließen. Historisch ist das völlig sicher und gut zu belegenfootnote. Es gab in der Frühen Kirche auch keinen allgemeinen und grundsätzlichen christlichen Pazifismusfootnote. Allerdings darf man ihn auch gar nicht erwarten. Denn wir hatten ja bereits gesehen: Die Bergpredigt regelt nicht das staatliche Leben. Sie regelt das Leben der Jesusjünger untereinander. Das ist also die eine Seite, auf die hingewiesen werden muss: Es gab viele Soldaten, die Christen waren.
Andererseits aber gab es tatsächlich Theologen der Alten Kirche, die es ablehnten, dass Christen Kriegsdienst leistetenfootnote. Der wichtigste dieser Theologen ist Origenes. Der Christengegner Kelsos hatte eine Schrift gegen die Christen verfasst. In ihr hatte er ihnen vorgeworfen, sie würden sich nicht am Erhalt des Staates beteiligen, sondern sich von der römischen Gesellschaft distanzieren. Sie würden zum Beispiel den Kaiser bei seinem Kampf gegen die Barbaren, die bereits die Grenzen des Reiches überfluteten, allein lassen.
Origenes antwortet im Jahre 248 in seiner Schrift „Contra Celsum“ der Sache nachfootnote: Ihr verlangt ja von euren Priestern auch nicht, dass sie Soldaten werden. Wir Christen aber sind alle Priester. Nämlich in dem Sinn, dass wir die Gesellschaft, in der wir leben, heiligen. Wir beten für den Kaiser. Wir beten dafür, dass gerecht regiert wird und dass nur gerechte Kriege geführt werden. Das ist wichtiger, als dass wir selbst Krieg führen.
Hier haben wir also eine überaus klar bezogene Position zu der Frage, ob ein Christ Soldat sein kann, und vor allem ein klares Bewusstsein von der eigentlichen und wichtigsten Aufgabe der Kirche in der Gesellschaft. Sie soll die heidnische Gesellschaft davor bewahren, sich in Kriegen, die aus Habgier und Eroberungslust geführt werden, selbst zu zerstören. Damit sind wir ganz nahe bei der Bergpredigt und ganz nahe bei dem, was das Gottesvolk im Sinne Jesu sein soll: Sauerteig für die Gesellschaft – gerade durch seine Gewaltlosigkeit.
Im Übrigen ist es keineswegs so, dass wir, was den Militärdienst angeht, nur die Stimme von Theologen hätten. In zumindest einer Kirchenordnung hat sich die ganze Frage auch rechtlich niedergeschlagenfootnote. In der Hippolyt (um 170–235) zugeschriebenen „Traditio Apostolica“, einer Kirchenordnung, von der wir nicht wissen, wann und wo sie in Geltung war, heißt esfootnote:
Ein Soldatfootnote unter Befehlsgewalt darf niemanden töten. Wenn er dazu den Befehl erhält, darf er ihn nicht befolgen. Auch darf er keinen Eid leisten. Geht er darauf nicht ein, so weise man ihn [als Taufbewerber] ab. Wer die Schwertgewalt hat oder Stadtmagistrat ist und den Purpur trägt, muss von seinem Amt zurücktreten. Andernfalls weise man ihn [als Taufbewerber] ab. Wenn ein Taufbewerber oder ein Gläubiger Soldat werden will, weise man ihn ab, denn er hat Gott missachtet.
Ich betone: Diese Kirchenordnung war keineswegs in der ganzen Kirche verbreitet. Sie zeigt aber, dass der Gewaltverzicht Jesu im Bewusstsein der Christen – auch was die Frage des Kriegsdienstes anging – nicht völlig untergegangen war. Denn die „Traditio Apostolica“ setzt zwar die Existenz christlicher Soldaten voraus, sagt aber, dass einer, der in den Stand der Katechumenen eingetreten ist, nicht mehr Soldat werden darf.

Die Nächstenliebe bei Jesus und in der Frühen Kirche
Als zweite Stichprobe wähle ich das Thema der Nächstenliebe, weil gerade dieses Thema heute mit einem schweren Missverständnis belastet ist. Denn es wird uns ja ständig eingeredet: „Du kannst den Anderen nur lieben, wenn du dich zuerst einmal selbst liebst.“ Das beschwören nicht nur Psychologen und Psychotherapeuten. Es ist das Hauptthema der religiösen „Erbauungsliteratur“ des 21. Jahrhunderts.
Es ist ja auch nicht völlig falsch. Selbst-Annahme ist wichtig und kann sogar etwas zutiefst Christliches sein. Falsch wird die Sache nur, wenn sie auf unentwegte, lustvolle Selbstfindung hinausläuft. Und falsch wird die Sache vor allem dann, wenn behauptet wird, das „…wie dich selbst“ des Liebesgebotes begründe Selbstliebe und Selbstannahme. Denn in der Bibel ist die Selbstannahme keineswegs die Basis der Nächstenliebe. Die Bibel redet überhaupt nicht von Selbst-Annahme, sondern von Umkehr, und auch nicht von Versöhnung mit sich selbst, sondern von Versöhnung mit Gott und dem Nächsten.
In der Bibel meint das „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ gar nicht das individuelle „Ich“ im modernen Sinn. Das „Ich“ ist hier vielmehr die eigene Familie. Man kann das sehr schön an der Berufung Abrahams sehen. Gott sagt ja zu Abraham:
Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. (Gen 12,2)
Wen meint denn dieses „du“ und dieses „dich“? Natürlich Abraham. Aber eben nicht Abraham allein. Denn mit ihm verlassen die alte Heimat seine Frau Sara, sein Neffe Lot, sowie die Knechte und Mägde, die sie in Haran gewonnen hatten (Gen 12,4-5). Das heißt: Abraham wandert mit seiner ganzen Großfamilie, mit seinem Vieh und seinen Zelten Kanaan entgegen.
Vor diesem Sprachhintergrund, der für das Alte Testament selbstverständlich ist, will das Gebot der Nächstenliebe aus Levitikus 19,18.34 sagen: Die Hilfe und Solidarität, die jeder in Israel der eigenen Verwandtschaft und vor allem der eigenen Familie schuldet, ist auf ganz Israel auszudehnen. Die Grenzen der eigenen Familie sind zu durchbrechen auf alle Brüder und Schwestern im Gottesvolk hin, selbst auf die Fremden, selbst auf diejenigen, die deiner Familie und deiner Verwandtschaft als Feinde gelten. Das will Levitikus 19 sagen. Und das ist milchstraßenweit entfernt von der individuellen Selbstliebe, die uns heute von vielen Seiten gepredigt wird.
In Levitikus 19 wird somit die Binnen-Solidarität, die dem „Ich“, also der Familie und dem Clan gilt, aufgesprengt und ausgeweitet auf ganz Israel. Selbst der Fremde im Gottesvolk hat nun Anspruch auf die gleiche Solidarität wie der leiblich Verwandte. Selbst die Fremden im Land sollen den Alteingesessenen zu Brüdern und Schwestern werden, sagt Levitikus 19. Das war keine Selbstverständlichkeit. Das ging gegen alle damaligen Werte und Regeln.
Jesus greift nun exakt diesen revolutionären Schritt der Exils-Theologie Israels auf. Ja, er radikalisiert ihn noch. Im Pentateuch stehen das Gebot der Gottesliebe und das Gebot der Nächstenliebe noch unverbunden nebeneinander – das eine in Deuteronomium 6, das andere in Levitikus 19. Jesus verknüpft beide Gebote miteinanderfootnote, mehr noch, er setzt das Gebot der Nächstenliebe dem Gebot der Gottesliebe an Wichtigkeit gleich (Mt 22,37-40). Beide Gebote sind für ihn überhaupt nicht zu trennen. Beide werden für ihn zur Mitte der Tora.
Aber das alles bleibt bei Jesus nun gerade nicht eine schöne Theorie. Es wird zum Zentrum dessen, was er tut. Als Jesus auftritt, ist das Gottesvolk ja zutiefst gespalten und zerrissen: in Samaritaner, Sadduzäer, Pharisäer, Zeloten und Essener. Jede dieser Gruppen und Religionsparteien feindet die andere an und beansprucht, das „wahre Israel“ zu sein, das allein dem Willen Gottes entspricht. Sieht man genau hin, so ist Jesus mit genau demselben Skandal konfrontiert wie wir heute: mit der Spaltung des Gottesvolkes.
Was macht er angesichts dieser Situation? Sein gesamtes Wirken, seine gesamte Reich-Gottes-Praxis läuft darauf hinaus, dieses zerrissene Israel angesichts der nahen Gottesherrschaft zu sammeln, zu einen und zu erneuern.
Und genau in diesen Kontext gehört sein Gebot der Nächsten- und Feindesliebe. Es handelt sich nicht um eine Fernstenliebe, die sozusagen alle Menschen umarmt und „im Geist“ zu Nächsten macht. Nein, es geht sehr konkret darum, die Feindschaften im Gottesvolk zu beseitigen und auch alle Fremden, die innerhalb des Gottesvolkes leben, brüderlich und schwesterlich zu behandeln. Anders gesagt: Sie so zu behandeln, dass sie aufgenommen sind in den Schutzraum gegenseitiger Achtung und Solidarität. Genau das ist biblisch mit agapē gemeint.
Hat die junge Kirche diese radikale Nächstenliebe, die für Jesus ein Signal der herandrängenden Gottesherrschaft war, begriffen und gelebt?
Es wäre an dieser Stelle sinnvoll, sich ausführlich mit den Paulusbriefen zu beschäftigen. Denn sie zeigen nicht nur, wie zentral bei Paulus die innergemeindliche agapē ist. Sie zeigen, dass für ihn die agapē wie schon im Alten Testament nicht in schönen Gefühlen besteht, sondern eben in gegenseitiger Annahme, in gegenseitiger Achtung, Hilfe und Solidarität. Für Paulus greift diese Solidarität sogar über die christliche Gemeinde hinaus. Dann spricht er allerdings nicht mehr von agapē, sondern vom „Gutes tun“footnote. Schließlich zeigen die Paulusbriefe, dass die christliche agapē ihren tiefsten Grund in dem sich am Kreuz hingebenden Jesus hat.
Doch ich gehe nicht weiter auf Paulus ein, sondern wende mich sofort der jungen Kirche im 2. und 3. Jahrhundert zu. Hat sie die gegenseitige agapē, also die Mitte der Reich-Gottes-Praxis Jesu gelebt? Hier wären nun viele Belege zu nennen – aus den Schriften der großen Theologen der Frühen Kirche wie aus den Schriften der Apologeten. Ich wähle zunächst drei christliche Texte aus.
Erstens einen wichtigen Text aus der Apologie des Justin, die er um die Jahre 150 / 155 verfasst hat. Der Text ist deshalb so bemerkenswert, weil wir hier, im 67. Kapitel von Justins Apologie, die älteste Schilderung der kirchlichen Eucharistiefeier vor uns haben. Justin beschreibt zunächst den Wortgottesdienst, dann kommt er auf die Predigt zu sprechen, nennt dann Fürbitten, Gabenbereitung, das Hochgebet mit dem „Amen“ der Gemeinde und die Austeilung der Kommunion. Schließlich, am Ende seiner Schilderung, sagt er noch etwas zur Kollekte, und zwar Folgendesfootnote:
Wer aber die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, soviel er will, und was da zusammenkommt, wird bei dem Vorsteher hinterlegt. Dieser kommt damit Waisen und Witwen zu Hilfe, solchen, die wegen Krankheit oder aus sonst einem Grunde bedürftig sind, den Gefangenen und den Fremdlingen, die in der Gemeinde anwesend sind.
Die sonntägliche Kollekte diente also allen in der Gemeinde, die Hilfe brauchten. Es handelte sich vor allem um Witwen, Waisen, Alte und Kranke; um die arbeitslosen, die gefangenen und die verbannten Mitchristen; um Christen auf der Durchreise und um alle aus der Gemeinde, die in eine besondere Notlage geraten waren. Hinzu kam die Sorge um ein würdiges Begräbnis der Armen.
Damit war ein Netz sozialer Sicherheit gegeben, das in der Antike einzigartig dastand. Es beruhte auf gegenseitiger Hilfe und freiwilligen Spenden, die eben in der Eucharistiefeier eingesammelt wurden. Wenn die frühen Christen von der agapē, der Nächstenliebe redeten, meinten sie genau diese gegenseitige Hilfe. Allerdings griff die agapē über die eigene Ortsgemeinde hinaus. So schreibt der Bischof Dionysios von Korinth um das Jahr 170 an die Gemeinde in Romfootnote:
Von Anfang an hattet Ihr den Brauch, allen Brüdern auf mannigfache Weise zu helfen und vielen Gemeinden in allen Städten Unterstützungen zu schicken. Durch die Gaben, die Ihr von jeher geschickt habt, da Ihr als Römer einem überlieferten römischen Brauch folgt, erleichtert Ihr die Armut der Dürftigen und unterstützt Ihr die in den Bergwerkenfootnote lebenden Brüder. Euer heiliger Bischof Soter hat diesen Brauch nicht nur festgehalten, er hat ihn sogar noch erweitert.
Nächstenliebe blieb also kein leeres Wort: weder innerhalb der einzelnen Gemeinde noch innerhalb der Gesamtkirche. Die agapē erwies sich als ein handfestes Konzept, wirtschaftliche und soziale Nöte innerhalb der Kirche in den Griff zu bekommen. Es ging dabei freilich nicht nur um wirtschaftliche Nöte. Als um das Jahr 260 in der Großstadt Alexandrien die Pest wütete, schrieb der dortige Bischof Dionysios in einem Brieffootnote:
Da die meisten unserer Brüder in übermäßiger Liebe und Freundlichkeit sich selbst nicht schonten und aneinander hingen, furchtlos sich der Kranken annahmen, sie sorgfältig pflegten und ihnen in Christus dienten, starben sie gleich diesen […] dahin, angesteckt vom Leide anderer, die Krankheit der Mitmenschen sich zuziehend, freiwillig ihre Schmerzen übernehmend. […] Auf solche Weise schieden aus dem Leben die Tüchtigsten unserer Brüder: Presbyter, Diakone und Laien. […] Weil sie die Leiber der Heiligen auf ihre Arme und ihren Schoß nahmen, ihnen die Augen zudrückten und den Mund schlossen, sie auf die Schulter luden und unter herzlichen Umarmungen nach Waschung und Bekleidung bestatteten, erfuhren sie kurz darauf dieselben Dienstleistungen, wobei die Überlebenden stets an die Stelle derer traten, die vorausgegangen waren.
Ganz anders war es bei den Heiden. Sie stießen die, welche anfingen krank zu werden, von sich, flohen vor ihren Teuersten, warfen sie halbtot auf die Straße und ließen ihre Toten unbeerdigt wie Schmutz liegen.
Der heutige Christ pflegt angesichts eines solchen Textes zu sagen: So darf man nicht verallgemeinern. Das ist das Schwarz-Weiß der Legende. Es gibt stets Christen, die versagen, und es gibt stets auch bei Nichtchristen vorbildliches Verhalten. Selbstverständlich ist das richtig. Trotzdem wird man dem zitierten Text des Bischofs Dionysios nicht einfach Verfälschung von Fakten unterstellen dürfen. Und selbst wer dies tun würde, müsste doch zugeben: Zumindest sahen die Christen sich so und wollten so sein.
Nun habe ich mich bisher immer auf christliche Quellen gestützt. Deshalb möchte ich wenigstens noch eine heidnische Quelle zitieren – es ist nicht die einzige, die man zitieren könnte. Der römische Kaiser Julian, ein dezidierter Gegner des Christentums, schreibt um das Jahr 362 an Arsakios, den heidnischen Oberpriester von Galatien, Folgendesfootnote:
Begreifen wir denn nicht, dass die Gottlosigkeit [= das Christentum] am meisten gefördert wurde durch die Menschenliebe [philanthrōpia] [der Christen] gegenüber den Fremden und durch die Fürsorge [der Christen] für die Bestattung der Toten? […] Die gottlosen Galiläer ernähren außer ihren eigenen Armen auch noch die unsrigen; die unsrigen aber ermangeln offenbar unserer Fürsorge.
Und in einem ähnlich programmatischen Brief an Theodoros, den Oberpriester der Provinz Asia, schreibt der Kaiserfootnote:
Da es nämlich, so meine ich, dahin gekommen ist, dass die Armen von unseren Priestern unbeachtet blieben und vernachlässigt wurden, haben die gottlosen Galiläer, die das bemerkten, sich auf diese Praxis der Menschenliebe [philanthrōpia] verlegt.“
Natürlich ist das eine Verdrehung der christlichen agapē. Die Christen haben sich nicht auf sie „verlegt“, um Heiden zu ködern, sondern weil die Tora und Jesus die agapē einfordern als Antwort auf die Liebe Gottes.
Auch dieser Brief des Kaisers Julian zeigt: Was die Apologeten über die innere Solidarität der christlichen Gemeinden sagten, stimmte offenbar. Das soziale System der Kirche funktionierte sogar so gut, dass selbst Nichtchristen unterstützt werden konnten. Diese Solidarität muss auf Außenstehende einen tiefen Eindruck gemacht haben; sie war einer der Gründe für die schnelle Ausbreitung des Christentums.
Julian versuchte übrigens, das Unterstützungssystem der Gemeinden nachzuahmen, um den Christen diese Waffe zu entreißen. Sein Ziel war, eine Art hellenischer „Kirche“ zu errichten, in der es nach dem Vorbild der christlichen Kirche Armenfürsorge und Gottesdienste mit Predigt gab.
Kaiser Julian fiel nach nur zweijähriger Regierungszeit im Kampf gegen die Perser. Sein Versuch wäre mit Sicherheit gescheitert. Die Stärke und Unnachahmlichkeit des kirchlichen Unterstützungswesens lag eben gerade darin, dass es nicht zentral und nicht von oben dekretiert wurde, sondern seinen Sitz in den einzelnen Gemeinden hatte und dort aus der inneren Überzeugung und dem freien Konsens der Gemeinden ständig neu geboren wurde. Sein letzter Ursprung war die Bruderliebe und sein eigentlicher Ort die Eucharistiefeier der am Herrentag versammelten Gemeinden.