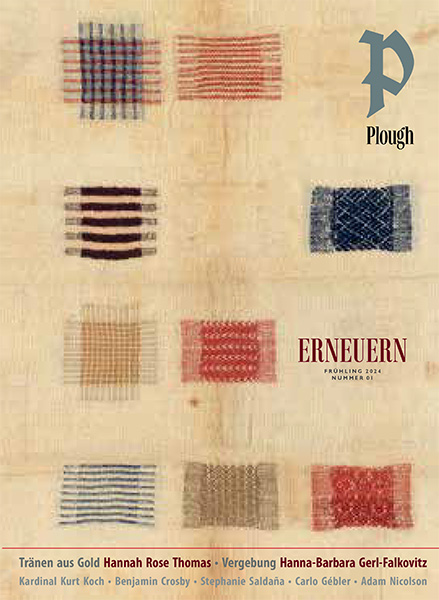Subtotal: $
Checkout
Ich arbeitete als Krankenpfleger im San Francisco General Hospital auf der AIDS-Station. Einer der dortigen Patienten war ein ehemaliger Pornostar, der zudem an leichter Demenz litt. Offensichtlich, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, lief er immer wieder nackt auf der Station umher. Bis die Oberschwester eines Tages das gesamte Betreuungspersonal zu einer Fallbesprechung in unserem kleinen Pausenraum zusammentrommelte. Dort versammelten sich sowohl sein Hausarzt und behandelnder Arzt, sein Sozialarbeiter, das Krankenpflegeteam, der Shanti-Berater und der Psychiater des Patienten. Die Gruppe diskutierte über Medikationen und mögliche hilfreiche therapeutische Maßnahmen.
Nach einigem Hin und Her warf dann schließlich jemand in die Diskussion: „Was er im Grunde braucht, ist eine Familie”. Eine lange Pause folgte. Jeder erkannte, dass dieser Einwurf richtig war, doch wussten wir alle ebenso: Ein Krankenhaus kann einem Mann keine Familie bieten.
Institutionen fördern Effizienz, Professionalität und Kapazität. Für das Gesundheitswesen mag das gut sein. Doch Institutionen können nicht lieben – nicht einmal die besonders wohlmeinenden, gemeinnützigen, karitativen Sozialunternehmen.
Denn: Wo es um Essen, Kindererziehung, Kirchen – und insbesondere Liebe geht, gilt es, unser Tempo zu verlangsamen und uns jedem Einzelnen persönlich zuzuwenden.
Doch Institutionen können nicht lieben – nicht einmal die besonders wohlmeinenden, gemeinnützigen, karitativen Sozialunternehmen.
Auch in meiner derzeitigen Tätigkeit als Hauskrankenpfleger bin ich weiterhin mit der Unfähigkeit von Institutionen konfrontiert, Liebe als Massenware zu produzieren. Eine meiner früheren Patientinnen, eine Frau im Rollstuhl, lebt allein in einer einkommensschwachen Wohngegend in San Francisco. Ihre makellose Wohnung im 12. Stock bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die Innenstadt. Sie hat einen Fallmanager, eine Pflegekraft, einen Arzt, einen Psychologen, einen Sozialarbeiter, einen Finanzmanager und einen Lebensmittellieferdienst. Und dennoch bleibt ihre Seele voll Traurigkeit, weil sie sich trostlos einsam fühlt.
Ich begann meine Arbeit als Pfleger mit Anfang zwanzig. Ein Mentor hatte mich gelehrt, dass Gott eine besondere Liebe für die Armen hat und herausgefordert, die schlichte logische Folgerung zu akzeptieren, dass auch wir sie lieben sollen. Angespornt durch diesen Ruf versuchte ich anfangs, die Armen zu lieben, indem ich in einem kostenlosen Rechtsberatungsbüro für Immigranten als Englischlehrer bei World Relief arbeitete. Zudem reiste ich neun Monate lang durch Mittelamerika und lernte Spanisch.
Durch diese Erfahrungen habe ich eines über mich selbst gelernt: Ich liebe die Vorstellung, dass ich die Armen liebe – aber ich liebe nicht die Armen.
Armut schädigt Menschen. Sie kann hilfsbedürftig, depressiv und krank machen. Arme zu lieben, kann deshalb schwer sein. Dies mag erklären, warum wir so sehr daran interessiert sind, den Armen zu dienen, die weit weg sind, und nur wenig für die in unserer Nähe tun. Wenn ich Ihnen erzähle, dass ich als AIDS-Krankenpfleger gearbeitet und politischen Flüchtlingen Englisch unterrichtet habe, dann stärkt das mein Ego und Sie mögen mich dafür bewundern. Doch die meisten von uns lieben nur selten eine bestimmte arme Person mit all den Opfern, Schwierigkeiten und Segnungen, die damit verbunden sind.
Als junger Mensch lernte ich durch Gottes Gnade und den Rat einiger älterer, weiser Menschen: Mehr als Bewunderung, Erfolg, Sex oder Geld brauche ich Liebe. Ich war ein introvertierter, unsportlicher, verklemmter Junge, der bis zur Highschool bereits siebzehn verschiedene Schulen besucht hatte. Ich war nicht gut darin, Liebe zu geben oder zu empfangen. Doch ich wusste, ich wollte es lernen. Mit vierundzwanzig Jahren schloss ich mich darum einer christlichen Gemeinschaft an, die sich der Liebe zu Gott und Menschen verschrieben hatte.
Seither bin ich täglich mit der Erkenntnis meiner Liebesarmut konfrontiert. Die Gemeinschaft macht meine eigene Armseligkeit offenbar.
Ich bleibe und erfahre die Fürsorge anderer, die denselben Prozess durchlaufen. Das Mitgefühl, mit dem sie auf meine Armut reagieren, die Erfahrung, in meinem Versagen erkannt und doch geliebt zu werden, trifft mein Herz immer wieder von Neuem wie eine Schocktherapie.
Liebe hält durch – trotz Versagens. Sie sucht demütig die Vergebung und Liebe von Gott und Menschen. Sie trachtet danach, andern zu vergeben und sie zu lieben – und sei es zum tausendsten Mal. Liebe ist selten, weil sie so schwerfällt. Mitglieder der Kommunität Simple Way, die für ihren Dienst an ihrer armen Nachbarschaft bekannt ist, behaupten: „Unser radikalstes Tun besteht in unserem Entschluss, einander zu lieben – immer und immer wieder neu.“
So schwierig Liebe auch sein mag, so heilend ist sie auch. Der kleine Haushalt, zu dem ich nun gehöre, gleicht einem Krankenhaus für die Seele. Einer meiner Mitbewohnerinnen, die sich selbst als „Verzweiflungsabhängige“ bezeichnet, hat den Satz „Gott ist gut“ zu ihrem grundlegenden Bekenntnis erhoben. Ein weiterer Mitbewohner, der vierzig Jahre lang Heroin konsumierte, setzt sich nun für andere ein, indem er wunderbare Mahlzeiten für die Gemeinschaft kocht und unsere Häuser und Autos instand hält. Und während ich selbst immer wieder in der Versuchung stehe, andere zu kritisieren und zu „reparieren“, bin ich dabei zu lernen, dass meine Neigung, mich andern überlegen zu fühlen, Menschen verletzt. Ich wachse in meiner Fähigkeit, andere zu bestätigen und anzuerkennen.
All diese Veränderungen vollziehen sich langsam, sind leise und zerbrechlich. Wenn ich darüber nachdenke, wird mir die Weisheit von Mutter Theresas Ermahnung bewusst, „kleine Dinge mit großer Liebe zu tun“. Liebe fühlt sich in der Regel klein an. Wenn die Liebe groß aufgezogen, kommerzialisiert, digitalisiert und fabriziert wird, mag dies in der Welt durchaus Gutes bewirken – aber es handelt sich nicht länger mehr um Liebe.
Meine Befürchtung ist: Indem wir unseren Arbeitsplätzen Priorität einräumen, gerät die Liebe von Mensch zu Mensch durch eine institutionalisierte Form der Fürsorge zunehmend in den Hintergrund.
Ich lebe in San Francisco, der Stadt der sozialen Start-up-Unternehmen. Sie wollen die Welt durch leistungsstarke Technologien retten - sofern man ihnen nur ausreichend Risikokapital dafür zur Verfügung stellt. Da meine ich manchmal, mich für unsere bescheidene Gemeinschaft entschuldigen zu müssen.
Oft kommen junge Menschen zu uns und wollen wissen, ob Gemeinschaft ihre großen Träume von Sinnerfüllung verwirklichen kann. Wenn ihr Blick dann auf unsere abgenutzten Möbel fällt, die an unsere Wohngemeinschaften erinnern, dann antworte ich ihnen: Gemeinschaft wird ihnen diesen Traum nicht erfüllen – aber sie könnte ihnen dabei helfen, mit ihrer eigenen Armut in Berührung zu kommen. Irgendwie scheinen meine Werbereden nicht von besonderem Erfolg gekrönt.
Ein wenig bin ich neidisch. Die umherreisenden jungen Menschen landen am Ende an sozial fortschrittlichen Arbeitsplätzen wie Google. Google bekommt die Leute, die gut drauf sind – und bei mir bleiben nur solche hängen, die so sind wie ich. Doch während Google ein Gefühl von Macht, bestechende Arbeitsplätze, Gourmet-Kantinen und schwindelerregende Löhne bietet, erhalte ich Liebe. Zu mir kommen Menschen, die mich zutiefst kennen, eine Geschichte mit mir teilen und treu zu mir stehen. Und was vielleicht das Wichtigste ist: Ich habe einen Ort, an dem ich das Heiligste und Menschlichste geben kann, das ich besitze – nämlich meine Liebe.

Ich bin nicht gegen Technologien oder Institutionen, die den Armen dienen. Doch wenn wir unsere beste Energie für anspruchsvolle Arbeitsplätze einsetzen, haben wir wenig Raum, um die Kunst der Liebe zu lernen. Natürlich will ich damit nicht sagen, wir könnten nicht lernen, richtig zu lieben, wenn wir uns für einen Arbeitsplatz entscheiden, der dem Gemeinwohl dient. Ich selbst arbeite Teilzeit in einer Einrichtung, die sich um die Armen in San Francisco kümmert, und ich bin über diesen Arbeitsplatz froh.
Doch meine Sorge bleibt: Wenn wir uns an erster Stelle für unsere Arbeitsstellen engagieren, wird die Liebe zum Einzelnen mehr und mehr durch eine stärker institutionalisierte Form von Fürsorge in den Hintergrund gedrängt. Oder, wie Mutter Teresa sagte: „Die größte Krankheit im Westen ist heute nicht mehr TB oder Lepra, sondern die Erfahrung, unerwünscht, ungeliebt und vernachlässigt zu sein. Körperliche Krankheiten können wir mit Medikamenten heilen, aber das einzige Mittel gegen Einsamkeit, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ist die Liebe. Es gibt viele auf der Welt, die sich nach einem Stück Brot sehnen, aber es gibt noch viel mehr, die sich nach ein wenig Liebe sehnen.“
Den wohlhabenden westlichen Christen unter uns schlage ich deshalb folgendes Experiment vor: Nehmen Sie doch eine Person, die (auf eine andere Weise als Sie selbst) arm ist, in das Netzwerk von Menschen auf, das Sie als Ihre Familie im weiteren Sinne betrachten. Bieten Sie einander die Freuden und Verpflichtungen an, die zu einer Familie gehören. Im Idealfall tun Sie das im Kontext Ihrer Kirche oder Gemeinde. Versuchen Sie, sich gegenseitig zu lieben, indem Sie jeweils die Liebe des anderen empfangen.
In einer Welt voll blendender technologischer Macht ist der Gedanke, Liebe ließe sich als Massenware produzieren, sehr verlockend.
Teresa von Avilas berühmter Ausspruch lautet: „Christus hat keinen Körper außer deinem. Keine Hände, keine Füße auf der Erde außer deinen.“ So schön dieses Bild auch ist, das biblische Bild vom Leib ist noch besser: Wir laufen nicht wie kleine Messiasse umher, um Bedürftigen Heilung zu bringen, sondern laden andere ein, mit uns gemeinsam Christus zu werden. Durch Liebe im Leib Christi zusammengewoben bieten wir einander an, was uns gegeben wurde und pflegen einander unsere Wunden. Indem wir die Gaben des anderen empfangen, verleihen wir einander Würde. Dieser liebende Austausch macht uns zu dem leuchtenden Wunder von Reich und Arm in Christus.
Es beunruhigt mich, dass dieses Wunder nur selten sichtbar wird. Denn in einer Welt blendender technologischer Macht ist der Gedanke verlockend, wir könnten Liebe als Massenware produzieren. Doch unpersönliche, von Institutionen fabrizierte Fürsorgeakte bieten der menschlichen Seele keine Nahrung. Selbst Gott, der Schöpfer des Universums, wurde klein, um einzelnen menschlichen Seelen Liebe zu bringen. Lassen Sie uns seinem Vorbild folgen.

 Tim Otto
Tim Otto
Tim Otto ist Pastor an der Church of the Sojourners in San Francisco, Mitautor von Inhabiting the Church: Biblical Wisdom for a New Monasticism, und twittert unter @Tim_Otto.